Kiev-60 und Objektive von Carl Zeiss Jena

Nachdem ich lange Zeit mit Nikon gearbeiten habe kam der Gedanke: was unterscheidet meine Fotos von denen, die ein Profi macht? Mittelformat! (Nennen Sie es jugendliche Torheit.) Mein Bruder verwendete damals vorwiegend eine Kiev-88 (sieht aus wie eine Hasselblad), aber irgendwie war ich noch zu sehr an SLR gebunden und da war die Kiev-60 (K60) die logische Alternative. Günstig übers Internet oder auf einer Fotobörse erstanden und schon ist man im Mittelfortmat angelangt.
Aber Body und Volnar 80mm-Normalobjektiv sind erst die Einstiegsdroge. Rund um das Pentacon-Bajonett gibt es eine umfangreiche Objektiv- und Zubehörpalette, welche die Funktionen der Kamera, die übrigens noch immer in Kiev gebaut wird, für viele Einsatzzwecke erweitern und dennoch nicht die Welt kosten. Begleiten Sie mich auf eine Reise ins mechanische Wunderland.
| Geschichte - die K60 und ihrer Geschwister |
| Kiev-60 im Detail - einer KB-SLR gar nicht so unähnlich |
| TTL-Messprisma - das wichtigste “Zubehör” |
| Carl Zeiss Jena - Objektive mit Legendencharakter |
| weitere Objektive - auch andere Mütter haben schöne Töchter |
| Zubehör - für Makro- und Telefotografie |
| Qualität - bekannte Probleme und deren Lösung |
| Galerie - Bilder, die mit der Kiev-60 entstanden sind |
| Conclusio - für wen und wofür ist dieses System geeignet |
| Links und andere Quellen |
Geschichte
Die Kiev 60 (K60) gehört zu einer Familie von Mittelformatkameras, die alle das Pentacon-Bajonett gemeinsam haben. Eigentlich ist es das Praktisix (P6) - Bajonett, denn so hieß 1956 die erste Kamera, die damit ausgestattet wurde. 1966 wurde der Nachfolger, die Pentacon six, vorgestellt. Beide Kameras entstanden in Dresden, wo sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Zentrum deutscher Kamera- und Filmindustrie befand, mit Firmen wie Ernemann, Balda, Zeiss-Icon, Ihagee und Pentacon.
Das geniale Idee hinter der Praktisix war, eine Praktica-Kleinbildkamera einfach etwas grösser zu bauen. Das, dachten sich die Russen, können wir auch und so wurden in der Ukraine (Firma Arsenal in Kiev) ab 1984 die K6C und danach die K60 gebaut. Aber wie das manchmal bei Kopien von Kopien der Fall ist, wurde nicht nur am Preis, sondern auch an einigen technischen Details gespart. Keines von beiden wiederum war ein Thema für den letzen Enkel der P6-Familie, der Exakta 66. Dieser aus Nürnberg stammende Vertreter westdeutscher Präzision wurden bis 2000 gefertigt und entspricht heute noch am ehesten dem, was wir von einer professionellen Kamera erwarten.
Vor dem Fall des Eisernen Vorhanges kamen nicht viele Modelle der K60 in den Westen. Die geringe Gewinnspanne in Verbindung mit der mechanischen Unzuverlässigkeit in Folge der schlechten Produktkontrolle machte sie für Händler nicht attraktiv genug. Im Osten war das anders. Dort ersetzte sie bei Profis die Flexaret-TLR-Kameras von Meopta. Und mit Zeiss/Jena hatte man einen Produzenten hervorragender Objektive im eigenen Lager.
Kiev-60
| Modellbezeichnung | Kiev 6C/60 |
| Hersteller | Arsenal/Kiev |
| Baujahr | seit 1984 |
| Filmformat | 120: 6x6 (4.5x6 Umbau) 220 (nur 6C) |
| Verschluss | Tuchverschluss, 1/2-1/1000, B |
| Filmtransport | Transporthebel rechts |
| Sucher | Lichtschacht und TTL-Prisma |
| Belichtungsmessung | TTL-Prisma: ungekoppelt, mittenbetont |
| Mattscheibe(n) | auswechselbar |
| Auslöser | Druckknopf am Gehäuse (6C: links, 60: rechts) |
| Blitzauslöser | X-Kontakt |
| Zubehörschuh | ja, abnehmbar |
| Objektivanschluss | P6-Bajonett |
| verfügbare Objektive | 30mm-1000mm |
| Stativanschluss | 3/8" |
Die Kiev ist eine SLR-Mittelformatkamera mit Wechselobjektiven und -suchern. Die Verschlusszeiten von 1/2 bis 1/1000 Sekunde werden mechanisch gebildet und laufen wie ein Uhrwerk ab. Die einzige Batterie sitzt im TTL-Prisma, das nicht mit der Kamera gekoppelt ist (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Als Film wird der Typ 120 (6x6, 12 Aufnahmen) verwendet. Beim Vorläufer, der Kiev 6C, konnte auch noch der Typ 220 (24 Aufnahmen) verwendet werden. Auf Wunsch gibt es einen Umbau auf 4.5x6. Die Rückwand ist aufklappbar und der Filmwechsel ist recht einfach.
Die Handhabung unterscheidet sich kaum von einer mechanischen Kleinbild-SLR. Durch den Filmtransport (Schnellspannhebel würde ich nicht dazu sagen, man sollte den Hebel immer kontrolliert zurückführen um die Mechanik zu schonen) wird der Verschluss gespannt und der Spiegel in die Ausgangslage gebracht. Durch den Prismensucher erfolgt Motivwahl und Scharfstellung. Mit einem kleinen Hebel rechts unter dem Auslöser kann das Objektiv zur Schärfekontrolle abgeblendet werden. Dann löst man aus und das wars auch schon. Der Spiegel bleibt hochgekplappt, bis Sie den Verschluss wieder spannen.
Wenn Sie das erstemal eine K60 auslösen, erschrecken Sie nicht. Die Erschütterung, die durch das Gehäuse läuft, ist normal. Was dabei abläuft ist folgendes: die Blendenlamellen schliessen sich, der Spiegel klappt hoch und dann erst löst der Tuchverschluss seinen waagrechten Ablauf aus. In Kombination mit den höheren Massen und Teiletoleranzen gegenüber einer modernen SLR ergibt das dann schon ordentlich “good vibrations”. Ein Stativ ist bei Telebrennweiten unbedingt zu empfehlen, auch wegen des höheren Gewichtes.
Bei Zeiten von 1/30 und länger wäre die Verwendung der Spiegelvorauslösung (MLU) zu überlegen, sofern Ihr Modell dazu umgebaut wurde. Es gibt im Internet einige Anleitungen für den Umbau, mit unterschiedlichen Ansätzen und Ergebnissen. Bei den Links finden Sie Firmen, die das auch für Sie erledigen.
Ab Werk wurde die Kiev (und wird sie noch immer) sowohl als Kamera mit Prisma und dem Volnar 80/2.8 Objektiv verkauft, als auch als Kiev-Set, bei dem zusätzlich der Lichtschachtsucher, zwei Filter (gelb und grün), Makrozwischenringe, ein Zubehörschuh und eine Tragtasche enthalten sind. Mit dieser Ausrüstung lässt sich schon viel anfangen.
TTL-Messprisma

Für mich das wichtigste Zubehör, weil die Kamera oft nur mit dem Lichtschachtsucher angeboten wird. Der macht durchaus an einer Rolleiflex Sinn und man kann auch an der K60 mit einem Lichtschachtsucher arbeiten, aber mit dem Prisma fühle ich mich einfach wohler. Das ist übrigens so gut, dass es gerne auch für andere Kameras, beispielsweise Mamiyas C-Serie, Hasselblad und Rolleiflex, adaptiert wird.
Es handelt sich um ein ungekoppeltes Messsystem, dessen Größe durchaus auf das Gewicht schließen lässt. Die Ergebnisse der mittenbetonten Belichtungsmessung sind ausreichend genau (bei Diafilm würde ich dennoch mit einem Spotbelichtungsmesser arbeiten), lediglich die Handhabung ist umständlich. Dazu stellen Sie am Prisma die Filmempfindlichkeit und die Arbeitsblende ihres gerade verwendeten Objektives ein. Nach Start der Messung am Prisma (Schiebeschalter rechts) leuchtet eine rote LED im Sucher auf. Beim drehen des Knopfes am Prisma springt plötzlich der Lichtpunkt auf eine zweite LED über. Drehen Sie langsam zurück, bis beide LED leuchten, lesen sie die korrekte Belichtung am Drehknopf ab und übertragen Sie den Wert auf die Kamera. Mit etwas Übung ereldigen Sie den Abgleich und die Übertragung dann in 5 Sekunden.
Ein kleines Problem sind die Quecksilber-Batterien, die eigentlich nicht mehr erhältlich sind. Alternativ können sie drei Knopfzellen LR44/SR44 verwenden. Um den geringenen Durchmesser der Zellen auszugleichen gibt es kleine Plastikröhrchen (s. Links und eBay). Mit ein wenig Geschick können Sie das aber auch selbst anfertigen.
Objektive von CZJ
Bevor ich einige Objektive beschreibe, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, ein Wort zur Warnung. Es ist nicht leicht, einen objektiven Standpunkt in Bezug zum eigenen Equipment einzunehmen. Nach dem Kauf tendiert man dazu, die Vorteile zu betonen und die Nachteile zu ignorieren, um seinen Kauf zu rechtfertigen. Ich bitte Sie, meine Meinung als genau das zu nehmen, was sie ist: subjektiv und, in Ermangelung einer Vergleichsmöglichkeit, voreingenommen. Ich verspreche, mich zu bessern.
Für das P6-Bajonett produzierte u.a. auch Zeiss/Jena (und in Folge Pentacon) Linsen mit hervorragenden Eigenschaften. Flektogon, Biometar, Sonnar - das sind Namen, die bei Kennern einen guten Klang haben und uneingeschränkt für Farb- und SW-Film geeignet sind. Sie beruhen auf klassischen Berechnungen und haben eine hohe Lichtstärke (für Mittelformat-Verhältnisse). Wenn Sie wissen wollen, was das Equivalent zu Ihren KB-Brennweiten ist, multiplizieren Sie sie mit dem Faktor 1.6 (aus 50mm KB wird dann 80mm im Mittelformat).
Im Internet finden Sie viele verschiedene Varianten dieser Objektive, da der gleiche optische Aufbau für verschiedene Kamerasysteme und Aufnahmeformate umgesetzt wurde. Achten Sie deshalb auf die Anschlussbezeichnung und vor allem die Kombination Brennweite/Arbeitsblende. Ein 180er-Sonnar wurde nur für das Mittelformat gebaut.
Leichtbau war bei Zeiss in der Mittelformatklasse kein Thema, Plastik finden Sie in dieser Sparte höchstens bei Streulichtblenden, sonst nur Glas und Metall. Da die Linsen über viele Jahre gebaut wurden, gibt es sie in verschiedenen Varianten, die sich aber nicht im Aufbau, sondern im Äusseren und der optischen Vergütung unterscheiden:
| V1: Leder | erste Version, silbern, der Entfernungsring (und der vordere Tubus beim Flektogon) sind mit einer lederartig strukturierten Hülle überzogen, die Frontlinsen sind einfachvergütet |
|---|---|
| V2: Zebradesign | so genannt, weil der Blenden- und Scharfstellring aus hellen und dunklen Streifen bestehen; sonst scharze Oberflächen, die Frontlinsen sind immer noch einfachvergütet |
| V3: MC (Multicoated) | letzte Version, völlig schwarze Gehäuse mit mehrfachvergüteten Frontlinsen |
Ich besitze die MC-Versionen, weil es die jüngsten (oder besser: die am wenigsten alten) sind. Ich habe aber noch keinen Vergleich zwischen den Generationen 2 und 3 gefunden, der einen signifikanten Vorteil für eine der beiden Seiten aufgezeigt hätte. Die aufwändigere Vergütung des MC sollte bei schwierigen Lichtsituationen bessere Kontraste liefern. Fertigungstoleranzen und Dejustierung der optische Achse infolge von Stürzen oder unsachgemäßer Wartung haben aber größere Auswirkungen auf die Bildqualität, im Zweifelsfall ziehe ich ein neuwertiges Zebra einem ramponierten MC vor. Die Version 1 taucht heutzutage schon seltener auf. Beim 65mm-Flektogon wurde übrigens nie eine Variante 3 gebaut.
Bei Kievaholic und Pentaconsix.com fand ich zwei Vergleichstests veschiedener Mittelformatlinsen. Die kann ich ihnen wirklich empfehlen, weil dabei Aufnahmen vieler verschiedene MF-Linsen direkt verglichen werden können. Dabei schneiden CZJ ganz gut ab und da die Preise bei eBay (damals) sehr günstig waren, habe ich mir die üblichen Verdächtigen vorgeladen. Ich habe sie alle behalten.

Flektogon 50/4 MC
Diese schwarze Schönheit entspricht einem 30mm-KB-Objektiv. Die große Frontlinse ist ehrfurchtgebietend. Noch weiter gewinnt sie an Format, wenn man die (bei Weitwinkel sowieso zu empfehlende) Streulichtblende mit dem Adapter von M86 auf M92 anschraubt. Diese übergroße Blende ist sehr wirkungsvoll und vignettiert nicht. Ein M86-Filter sollte sich auch noch dazwischen ausgehen, aber wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, verwenden Sie einen Adapter-Filter, der ebenfalls auf M92 aufmacht. Ja, die sind selten, ich habe bisher nur einen Gelbfilter gefunden.
Wie alle Objektive von Zeiss hat das Flektogon einen Abblendhebel, der sich, wenn es an der Kamera motiert ist, rechts in der Nähe des Bajonett findet. Da die Kamera selbst auch so eine Hebel aufweist, kommt einem das doppelt gemoppelt vor. Aber bei Verwendung des Balgengerätes gibt es keine Springblendenübertragung!
Die optischen Verzerrungen halten sich in Grenzen. Sicher, ein ausgesprochenes Repro-Objektiv ist es nicht, aber dafür ist es scharf, kontrastreich und hat mir auch bei Architekturaufnahmen nie Probleme bereitet. Es soll Leute geben, die kaufen sich nur wegen des Flektogons eine Kamera mit P6-Bajonett.
Siehe dazu auch mein Vergleich zwischen Kiev-60 mit Flektogon und Nikon D200 mit Nikkor 20/2.8

Biometar 80/2.8 MC
Auch hier habe ich das modernere MC-Modell genommen. Beim Biometar handelt es sich um das Normalobjektiv, es entspricht einem 50mm-KB. Im Vergleich zum Flektonon wirkt es fast zierlich. Das Filtergewinde M58 war im Ostblock recht verbreitet, immer wieder findet man schöne SW-Filtersets in dieser Größe. Genauso unspektakulär wie das Äussere sind die Resultate mit ihm. Als immer-drauf-Objektiv kann ich es empfehlen, damit ist die Kamera noch durchaus für einen ausgedehnten Stadtbummel geeignet. Die Streulichtblende ist auch viel dezenter als beim Flektogon.
Ob das Biometar zur Erstausstattung der Praktisix/Pentacon six gehörte, weiss ich nicht. Viele dieser Modelle werden heute in Kombination mit ihm angeboten, sodass es leichte sein könnte, es mit einer Kamera als Beifang zu erstehen. Aber auch einzeln tauchen es immer wieder auf und sollte eigentlich in keiner Ausrüstung fehlen.

Sonnar 180/2.8 MC
Wieder ein grosser Brocken. Das Sonnar ist für seine Brennweite (entspricht 110mm-KB) sehr lichtstark und entsprechend gross ist die Frontlinse mit ihrem 86mm-Gewinde. Aus der Hand arbeitet man damit nur noch, wenn man die Kamera irgendwo abstützen kann. Das Objektiv hat einen Stativring, der mit einer K60 recht ordentlich ausgewogen ist. Wenn Sie mit offener Blende arbeiten erhalten Sie wunderschön freigestellte Objekte und das Bokeh ist sehr angenehm. Für Portraits sollte man wegen der geringen Schärfentiefe aber mindestens 2-3 Blenden zumachen.
Das Design des Sonnar geht auf die Zeit vor dem 2. Weltkrieg zurück, wo es als Olympia-Sonnar 1938 für Leica produziert wurde. Solche Modelle findet man immer wieder bei Onlineauktionen, wo sie recht hohe Preise erzielen.
Aber zurück zum MF-Sonnar. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 86mm und dafür sind Filter schon recht teuer und nicht mehr so häufig. Gut, dass man am Flektogon die gleichen verwenden kann. Für Landschaftsaufnahmen empfehle ich immer die Streulichtblende, um den verringerten Kontrast entfernter Objekte nicht nochmals zu reduzieren.
Objektive anderer Hersteller
Zeiss war nicht der einzige Hersteller guter Optiken für das P6-System. Die Erstausstattung ist das recht ordentliche Volnar 80/2.8 und aus Russland kommen viele prinzipiell brauchbare MIR, Jupiter und Kaleinar. Das Problem ist hier wieder die Serienstreuung: wenn Sie drei kaufen, kann eines Spitze sein, eines ganz OK und eines definitiv unscharf. Nichts, was man nicht bei einem Service in Ordnung bringen könnte. Wenn Sie diesen Mehrpreis auf den Kaufpreis aufschlagen, relativiert sich die Einsparung gegenüber Zeiss schon merklich.
Der eigentliche Grund für die Anschaffung russischer Objektive ist aber, dass es dabei ungewöhnliche Brennweiten gibt. Sie werden für verschiedene Anschlüsse gebaut, erkennen können Sie die P6-Modelle an einem abschliesenden B im Namen des jeweiligen Modelles (z.B. MIR-3B, 65/3.5). Ich beschränke mich bei der Beschreibung auf die Optiken, mit denen ich bereits Erfahrungen gesammelt habe. In den schon erwähnten Vergleichstests finden Sie aber noch viel mehr.

Arsenal Zodiak-8 30/3.5
Wenn Ihnen das Flektogon gefällt, werden Sie das Zodiak auch mögen. In seinem Bildwinkel und der tonnenförmigen Verzeichnung ist es extremer, und die eingebaute Streulichtblende ist, bedingt durch den großen Bildwinkel, in ihrer Wirkung marginal, aber es ist ein ordentlicher Batzen Glas, das im Bildwinkel einem 19mm-KB entspricht. Die M38-Filter werden am kameraseitigen Ende eingeschaubt. Eines sollte immer drinnen sein, und wenn es nur das UV-Filter ist, da es Teil der optischen Formel ist. Wichtig ist auch, dass Sie das Zodiak mit dem Transportgehäuse kaufen, denn nur dann ist es auch geschützt. Ausserdem befindet sich die Filter im Deckel in einem eigenen Fach und sind dort in Halterungen eingeschraubt.
Wie sich vorstellen können ist es schwer, an einem sonnigen Tag keine Reflexionen einzufangen. Lernen Sie damit zu leben und Sie werden mit faszinierenden Fotos belohnt werden. Obwohl das Zodiak als Fisheye bezeichnet wird (was es aufgrund des Bildwinkels von 180 Grad auch ist), wird das volle Format ausgeleuchtet. Ich versuche, um mehr Dynamik in meine Aufnahmen zu bekommen, möglichst nahe an mein Hauptmotiv heranzugehen (30cm Naheinstellgrenze). Abblenden ist für die Tiefenschärfe nicht unbedingt nötig, sodass dieses Objektiv eigentlich eine tolle Aktionlinse darstellt.

Pentacon 300/4 MC
Schwer ist ein relativer Begriff. Dieses Objektiv ist jedenfalls mein schwerstes (2kg) und größtes. Auch von CZJ gab es eine Linse mit gleichen Eckdaten, das sogar mit einer Springblende ausgestattet ist. Dennoch habe ich mich für das Pentacon entschieden. Den Grund sehen Sie, wenn Sie durchschauen und abblenden. 17 Blendenlamellen (in Worten: siebzehn!) schliessen sich zu einer fast kreisrunden Iris. Bei soviel mechanischer Reibung kann keine federgesteuerte Blendenautomatik mithalten. Das ist aber nicht so schlimm, denn das Pentacon hat eine Vorwahlmechanik, mit der man eine Aufnahmeblende einstellt. Dann ist es ein einfacher Handgriff, um auf- und exakt abzublenden.
Optisch ist es sehr gut. Kein Wunder, schließlich war Zeiss/Jena ein Teil der Pentacon-VEB. Dass es ein eigenes Stativgewinde hat, versteht sich von selbst. Für das M92-Filtergewinde sind Filter dann schon wirklich teuer oder garnicht mehr erhältlich. Wenn Sie sich das 300er statt dem Sonnar nehmen und auch das Flektogon besitzen, dann wäre es möglich M92-Filter auf beiden Objektiven einzusetzen, da die Streulichtblende des Flektogon über einen M86-M92-Adapter angeschlossen wird.
Auf dem Bild sehen Sie im Vordergrund den Kiev K-6B 2fach-Konverter. Damit wird dann aus dem 300er ein 600er mit einem Gewicht, das nach einem wirklich stabilen Stativ verlangt. Auf Flugreisen sollten Sie sich vorher erkundigen, wie genau man es jeweils mit dem Gewicht des Handgepäcks nimmt. Die fünf hier abgebildeten Objektive und eine K60 ergeben in einem leichten Alukoffer immerhin 12kg.
Blitzfotografie

Die K60 ist mit einem Blitzkontakt mit X-Synchronisation ausgerüstet. Als Zubehör (oder Teil des K60-Kit) gibt es einen Zubehörschuh (s.u.). Was Sie nun noch brauchen ist ein Elektronenblitzgerät mit Kabelanschluss. Wenn Ihr Blitz nur einen sogenannten “Hot-shoe” hat, also einen Sockel mit Mittelkontakt, dann gibt es im Fotohandel Adapter von Kabel auf Hot-shoe, die zwischen Blitzsockel und Zubehörschuh gesteckt werden.
Die kürzeste Verschlusszeit, die Sie mit Blitz verwenden können, beträgt 1/30 Sekunde. Das ist die kürzeste Zeit, bei der der Verschluss komplett offen ist. Ab 1/60 beginnt der zweite Vorhand bereits, sich zu schliessen, bevor der erste Vorhang sich komplett geöffnet hat.
Bei Aufnahmen in Innenräumen haben Sie damit keine Probleme zu erwarten. Anders sieht es beim Einsatz als Aufhellblitz im Freien aus. Um 1/30 zu belichteten, müssen Sie an sonnigen Tagen auf f16 (die Sunny-16-Regel) oder f22 abblenden. Dann haben Sie aber gleich zwei Probleme: bei dieser kleinen Blendenöffnung muss der Blitz viel Licht liefern (d.h. geringe Reichweite) und Sie können nicht mehr mit selektiver Schärfe arbeiten, um ihr Objekt freizustellen. Letzteres lässt sich durch den Einsatz von Graufiltern umgehen. Für die große Blitzleistung verwende ich einen Sunpack-Stabblitz, der sein hohes Gewicht durch einen zusätzlichen Griff kompensieren hilft und über eine Blitzschiene mit der Kamera verbunden ist.
Wenn Sie unbedingt bei Hochzeiten fotografieren wollen, dann empfehle ich ihnen eine Kamera mit Zentralverschluss (Hasselblad, Bronica SQ). Oder Sie verzichten auf den Blitz und machen das Beste daraus, indem Sie einen Assistenten mit einem Reflektor zum aufhellen der Schatten einsetzen.
Zubehör
Dass es sich bei der K60 (und den anderen Kameras der P6-Familie) um ein System handelt, das erkennt man an den Zubehörteilen, die das Einsatzgebiet für verschiedene Zwecke, insbesonders Makrofotografie, erweitern. Einige Teile wie Zwischenringe und Zubehörschuh sind bereits im K60-Kit dabei.
2fach-Konverter
Das ist ein Zwischenring mit einer Linse, der die Brennweite des angesetzen Objektives unter Verlust zweier Blendenstufen verdoppelt. Aus dem Sonnar 180/2.8 wird ein 360/5.6. Solche Konverter sollten eigentlich nur bei Teleobjektiven eingesetzt werden, weil sie dafür optimiert sind. Es gibt verschiedene Hersteller, z.B. Schneider, Pentacon und Kiev, wobei man bei letzterem (K-6B) die Linse herausschrauben kann und dann einen 80mm-Makro-Zwischenring erhält. Eine Abbildung sehen Sie beim Pentacon-Objektiv. Der Konverter ist größer als das Normalobjektiv. Bei allen Konvertern wird die Funktion der Automatikblende mit einem Stössel auf die Linse übertragen.
Makro-Zwischenringe
Mit der K60 lassen sich ganz hervorragende Makroaufnahmen anfertigen. Was Sie dazu brauchen sind diese Zwischenringe. Es gibt sie in 4 Größen und verschiedenen Ausführungen (Metall/Kunststoff und schwarz oder silbern) und alle haben eine Übertragung der Springblende mit einem Stössel. Durch die Kombination mehrerer Ringe erhalten Sie eine beträchtliche Anzahl an Vergrößerungsfaktoren, die unterschiedliche Belichtungsverlängerungen verlangen. Kein Problem, wenn Sie mit dem TTL-Prisma arbeiten, das berücksichtigt ja bereits die reduzierte Lichtmenge. Bei einem Handbelichtungsmesser müssen Sie den Verlängerungsfaktor in der folgenden Liste auf ihre gemessene Belichtung aufschlagen. Ein Faktor von 2.0 bedeutet z.B., dass Sie um eine Blende weiter aufblenden müssen im Vergleich zu dem von Ihnen gemessenen Wert. Alternativ können Sie auch die Belichungszeit verdoppeln.

| 10 | 15 | 22 | 30 | 60 | Verl.Faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 1.4 | ||||
| X | 1.5 | ||||
| X | 1.8 | ||||
| X | 2.0 | ||||
| X | X | 2.3 | |||
| X | X | 2.6 | |||
| X | X | 2.8 | |||
| X | 3.1 | ||||
| X | X | X | 3.4 | ||
| X | X | 3.7 | |||
| X | X | 4.1 | |||
| 4.5 | |||||
| X | X | 4.9 | |||
| 5.3 | |||||
| X | X | X | 5.7 | ||
| X | X | X | X | 6.5 |
Eine Besonderheit ist der 10mm-Ring. Er ist der kleinste, der noch mit dem Bajonett möglich ist und er hat einen Anschluss für einen Drahtauslöser. Das brauchen Sie, wenn Sie den Faltenbalg (s.u.) einsetzen, denn der hat keine Übermittlung der Blendensteuerung. Deshalb wird der Doppelkabelauslöser mit dem Auslöser der Kamera und dem Zwischenring verbunden und wenn Sie damit auslösen, dann wird zuerst die Blende geschlossen.
Balgengerät

Grösser und flexibler als Zwischenringe ist der Makrobalgen. Er erlaubt einen weiteren Auszug auf Kosten der Blendenautomatik. Wie oben beschrieben verwendet man dann den 10mm-Zwischenring mit Kabelauslöseranschluss. Auf dem Foto ist der silberne Ring gut zu erkennen, ebenso der Doppeldrahtauslöser. Die Konstruktion ist sehr stabil und eigentlich unverwüstlich, wenn da nicht der Faltenbalg selbst wäre, der im Laufe der Jahre bei unsachgemäßer Lagerung brüchig und undicht wird. Prüfen Sie das immer vor dem Kauf, eine Reparatur ist aufwendig (es gibt Anleitungen, wie man den Balg selbst bauen kann).
Ohne Stativ werden Sie Probleme bei der Aufnahme bekommen. Das Sucherbild ist deutlich dunkler, die Schärfentiefe gering und durch den Vergrößerungsfaktor macht sich jedes Zittern bemerkbar.
Justierschlitten
Bei der Arbeit mit Zwischenringen oder Balgengerät kann man nur noch in beschränktem Umfang fokussieren. Viel einfacher ist es, die Kamera auf einen Schlitten zu montieren, der auf das Stativ kommt. Dann positioniert man das System einmal grob und fährt die Kamera am Schlitten vor und zurück, bis der interessante Teil des aufzunehmenden Objektes scharf ist. Die Konstruktion sieht zwar recht kompliziert aus, funktioniert aber hervorragend einfach und ist auch durch die dicken Rohre stabil genug.
Da wir gerade beim Stativ sind: russische Kameras haben häufig eine 3/8"-Gewindebuchse, während westliche Kameras eine 1/4"-Buchse aufweisen. Wenn Sie kein Stativ mit 3/8-Anschluss haben (mein Einbeinstativ hat eine Schraube mit beiden Durchmessern), dann gibt es Schraubeinsätze, die in die Buchse eingeschraubt werden. Einzeln kosten die unverschämt viel, bei Hama gibt es sie im Dutzend billiger.
Doppeldrahtauslöser
Den brauchen Sie, wenn Sie zwischen Kamera und Objektiv den Faltenbalg einsetzen. Dabei wird keine Steuerung der Automatikblende übertragen. Um nun dennoch in den Genuss dieser Arbeitserleichterung zu kommen wird einer der beiden Drahtauslöser in den Auslöser der Kamera geschraubt, während der zweite in den 10mm-Ring kommt, der zwischen Balg und Objektiv sitzt.
Wenn Sie sich die beiden Auslöser ansehen, erkennen Sie, dass einer beim Auslösen etwas früher herauskommt. Der gehört in den Zwischenring, damit sich die Blendenlamellen schon geschlossen haben, wenn der Verschluss in der Kamera startet. Sie sollten auch darauf achten, einen Kabelauslöser mit kurzen Anschlussstücken zu bekommen. Beim Zwischenring ist nur wenig Platz und der Nikon-Doppelauslöser beispielsweise lässt sich nicht einschrauben.
Lichtschachtsucher

Ursprünglich wurde die K6C und auch die K60 mit einem Lichtschachtsucher ausgeliefert. Prinzipiell ist das nur ein Streulichtschutz über der Suchermattscheibe, die mit einer Lupe und einem direkten Durchblick für Sportaufnahmen ausgestattet ist. Das Bild wird dabei durch das Objektiv über den Spiegel auf die Mattscheibe projeziert und ist dort aufrecht, aber seitenverkehrt zu sehen.
Theoretisch ist das Bild damit heller als mit dem Prismensucher und viele Mittelformatfotografen schätzen den guten Überblick über das gesamte Bild, den man bei der Benutzung des Lichtschachtsuchers hat. Im Freien ist das Bild aber durch Reflexionen überdeckt und eigentlich ist die Anordnung der Bedienelemente der Kamera für die Benutzung eines Prismas ausgelegt. Wenn Sie dennoch mit dem Lichtschacht arbeiten wollen, sollten sie die Mattscheibe unbedingt reinigen oder gleich eine hellere Scheibe einsetzen (lassen). Bei eBay werden immer wieder mal Beattie-Interscreen angeboten, aber billig ist das Vergnügen nicht. Sie gewinnen damit ca. 1 Blende an Helligkeit.
Eine Besonderheit, die ich bisher nur bei diesem System gefunden habe, ist die Scharfstellhilfe des Sportsuchers. Wenn Sie die Klappe im Sucherdeckel öffnen und durch die Lücke in der hinteren Wand hindurchvisieren, dann haben Sie natürlich keinerlei Information, ob das Bild korrekt scharfgestellt ist. Aber dafür gibt es in der Sucherrückwand, unterhalb der Visieröffnung, eine Linse, mit der man einen Ausschnitt der Mattscheibe sieht. Das ist aber nur ein Notbehelf, denn das Bild ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf.
Zubehörschuh
Ein unscheinbares Teil, das aber oft fehlt. Es wird links vom Objektiv auf die Kamerafront geschraubt und nimmt z.B. einen Blitz auf. Ich erwähne es nur, weil es zum K60-Kit gehört. Wenn Sie keines haben, dann gibt es Blitzschienen, die auch gleich einen zusätzlichen Griff und eine Halterung für einen Drahtauslöser bieten.
Kameragurt
Nachdem die Ausrüstung, wenn man Prisma und ein lichtstarkes Objektiv verwendet, schnell jenseits von 2 kg wiegt, hängt sich das ganz schön an. Gut dass die K60 Halter für einen Riemen hat. Leider nicht die gewohnten Ösen, sondern Adapter, die wie kleine Zierschrauben aussehen und in die Bajonettartige Riemenanschlüsse einrasten. Bevor Sie nun lange nach entsprechenden Originalriemen suchen, tun Sie sich etwas Gutes und besorgen Sie sich bei OP/tech USA den Super Pro Strap mit den Design A Adapteranschlüssen, wie sie auch die Hasselblad verwendet. (Nein, ich bekomme nichts für diese Werbung.)
Qualität
Auch wenn es weh tut, es muss gesagt werden: K60 sind nicht unbedingt für ihre Problemlosigkeit bekannt. Die Gründe sind Fertigungstoleranzen beim Hersteller und falsche Bedienung durch den Kunden gepaart mit der Erwartungshaltung, dass man für wenig Geld eine Kamera bekommt, die auch Qualitativ mit der hochpreisigen Konkurrenz mithalten kann. Was sind nun die Problemzonen und welche Möglichkeiten zur Behebung von Fehlern gibt es?
Ungleichmäßige Bildabstände
Wenn man den Film entwickelt und manche Bilder haben fast keinen Abstand zueinander oder überlappen sogar ein wenig, dann ist das mehr als ärgerlich. Häufig ist eine grobe Behandlung der Kamera mit daran Schuld. Schon bei der Praktisix hat es sich gerächt, den Schnellspannhebel unkontrolliert zurück schnalzen zu lassen. Dabei schlägt ein kleiner Stift auf das Transportzahnrad und mit der Zeit werden die Zähne dadurch abgenudelt. Das führt dann dazu, dass beim Filmtransport die rechte Filmrolle nicht mehr weit genug gedreht wird. Gewöhnen Sie sich besser gleich an, den Hebel immer mit dem Daumen kontrolliert in seine Ausgangsposition zurückzuführen. Wenn Ihre Kamera bereits in Mitleidenschaft gezogen ist, lassen Sie das Zahnrad austauschen.
Manchmal kommt es nur bei den ersten drei oder vier Bildern zu Überlappungen. Das ist aber nur zum Teil dem Hersteller anzulasten. Das Problem liegt darin begründet, dass das Filmmaterial im Ostblock mit einem dickeren Träger produziert wurde. Da Mittelformat-Film keine Perforation besitzt, wird der Transport durch die Dicke des Filmes und der Aufwickelrolle mitbestimmt.
Das ist dann auch der Ansatz für die einfachste Lösung: Sie kleben ein Stück Karton auf die Spule. Dadurch ist der Umfang der Spule größer und die Abstände ebenfalls. Wenn das letzte Bild nicht mehr ganz auf dem Film ist, nehmen Sie etwa vom Karton weg.
Wahrscheinlich rufen Sie jetzt: Pfusch! Und Recht haben Sie. Aber es geht auch professioneller. Dazu müsse Sie die Kamera zerlegen und eine Justierung vornehmen. Eine Anleitung finden Sie bei Kievaholic. An dieser Stelle gestatten Sie mir den Hinweis, dass Sie bei der K60 mit etwas Geschick viel selbst machen können. Professionelle Hilfe erhalten Sie u.a. bei Arax-Foto.
Mattscheiben-Justierung
Wenn die Position der Suchermattscheibe auch nur um einen Bruchteil eines Milimeters falsch ist, können Sie scharfstellen wie Sie wollen, die Ergebnisse sind nicht so scharf, wie sie sein sollten. Gut, dass die Abhilfe recht einfach ist. Um das Zerlegen der Kamera kommen Sie dennoch nicht herum. Details finden Sie wieder im Kievaholic-Artikel. Mein Tip: nehmen Sie ein Stativ, auf dem die geöffnete Kamera motiert wird und ein Teleobjektiv und stellen Sie es auf die Unendlich-Makre. Nun suchen Sie einen entfernten Gegenstand und betrachten ihn im Sucher. Ist er scharf? Wenn nicht, dann lösen Sie die vier Fixierschrauben der Suchermattscheibe und drehen langsam eine der vier Justierschrauben hinein und hinaus, bis das Bild in dieser Ecke scharf ist. Das wiederholen Sie bei den anderen drei Justierschrauben und fixieren die Mattscheibe danach. Beobachten Sie, ob sich dabei die Schärfe ändert und korrigieren Sie das nochmals. Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dann bauen Sie sich eine Hilfsmattscheibe mit einem Lupensucher, die Sie statt eines Filmes einsetzen und können damit auch gleichzeitig das Auflagemaß des Bajonett prüfen.
Reflexionen im Gehäuse
Auch wenn Sie bei der Aufnahme darauf achten, keine Lichtquelle im Bild zu haben, können Sie Reflexionen davon einfangen. Warum? Weil die Objektive (je größer die Frontlinse, desto mehr) auch seitliches Licht einfangen. Im Gegensatz zu Lensflares macht sich das nicht als scharf abgegrenzte Lichtreflexe bemerkbar sondern eher als Mangel an Kontrast. Denn diese vagabundierenden Lichtquellen werden nicht auf den Verschluss geleitete, sondern landet im Gehäuse zwischen Verschluss und Bajonett. Leider ist man in Kiev der Meinung, diese Stellen sollen glänzend schwarz sein. Na gut, immer noch besser als poliertes Aluminium, aber was können wir da machen?
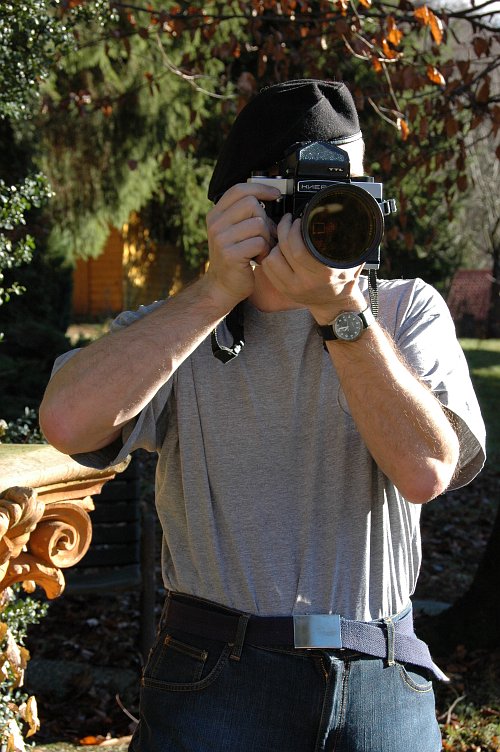
Die einfachste Lösung ist, sich ein Flocking Kit zu besorgen. Arax-Foto und Baier Fototechnik bieten so etwas an. Mit 10 Euro sind Sie dabei. Zur Montage schließen Sie einen Kabelauslöser am Gehäuse an, stellen den Verschluss auf “B”, lösen aus und fixieren den Drahtauslöser, sodass der Vorhang offen bleibt. Nun kommen Sie von beiden Seiten in’s Gehäuse und kleben die matten Teile hinein.
Billiger wird es, wenn sie diese Teile selbst anfertigen. Bei der Wahl des Materials haben sie mehrere Möglichkeiten. Eine mattschwarze, samtige Oberfläche mit einer selbstklebenden Rückseite ist die bequeme Variante. Sie können auch das heftige Auslösegeräusch mit der Wahl eines schweren Materials dämpfen. Wenn Sie mit Pattex (oder einem anderen Kleber, der stinkt, vertrauen Sie Ihrer Nase) arbeiten, dann lassen Sie das Gehäuse mindestens 1-2 Tage auslüften, bevor Sie einen Film einlegen.
Conclusio
Zuerst gleich, wofür die K60 nicht geeignet ist: unauffällig fotografieren, mit leichtem Gepäck reisen und Eindruck schinden. Denn sie ist groß, laut und schwer und das Design widerspricht unserem modernen, polierten Stilempfinden. Eine Legende war sie nie, ein Arbeitstier schon eher.
Beruflich würde ich damit nicht auftreten wollen. Ja, Sie können die Hochzeit ihres besten Freundes ablichten, mir wäre das Risiko aber zu groß. Bedenke Sie, dass es sich um ein einmaliges Ereignis handelt. Wollen Sie der Braut erklären, dass die Bilder nichts geworden sind, weil ein Rädchen in der Mechnanik gebrochen ist, und dass man damit bei alten Kameras eben rechnen müsse?
Urlaub und Fotoexkursionen sind schon eher ihr Metier. Wenn man sich entspannt und mehr Zeit für Schauen und Planen nimmt, dann kann sie ihre Stärken ausspielen. Die Auflösung des Mittelformatfilmes, die Details, die feinen Abstufungen beim SW-Film, die dichten Farben beim Dia in Verbindung mit den legendären Objektiven, das kann mich immer wieder überzeugen. Und plötzlich sind 12 Bilder pro Film keine Einschränkung mehr, sondern eine Hilfe, sich zuerst zu entscheiden, ob eine Aufnahme sinnvoll ist oder ob es nicht eine bessere Position oder spannenderen Bildaufbau gibt. Bezogen auf die Menge der Bilder komme ich mit mehr zufriedenstellenden Fotos heim als mit meiner Digitalkamera.
Auch die bereits angesprochene Makrofotografie ist ein lohnendes Gebiet mit der K60. Das reichhaltige Zubehör gerade für dieses Thema beinhaltet eigentlich alles, was man dafür braucht. Im Studio macht sie ebenfalls eine gute Figur. Hier ist die lange Blitzsynchronisationszeit von 1/30 Sekunde auch kein Hindernis.
Das alles soll Sie aber nicht davon abhalten, die K60 auf anderen Gebieten einzusetzen. Veranstaltungen und Streetfotografie allgemein lassen sich zwar mit einer KB-SLR leichter abdecken, doch ich betrachte das eher als Herausforderung denn als unüberwindliche Grenze. Die Aufmerksamkeit Ihrer Umgebung ist Ihnen sicher.
Hier gibt es einige Bilder, die ich mit der K60 aufgenommen habe.
Links und andere Quellen
| Kievaholic | Die Kiev-Selbsthilfegruppe: Reparaturtips und ein umfangreicher Objektivtest |
| Pentaconsix.com | ein überblick über das Pentaconsix-System, das Zubehör und ein Vergleichstest von Linsen, die P6-Bajonett besitzen. Lesenswert, weil der Autor seine Ergebnisse auch interpretiert. |
| Arax-Foto | Reparatur, Modifikation (MLU - Mirror Lockup) und neue Belederung für K60 und K88 |
| Baier Fototechnik | Zubehör und Modifikation (MLU, Kiev-Prismen auf Mamiya C/Rolleiflex) und Adapter von P6-Linsen an versch. Kamerasysteme |
| K60 DIY | Reparatur- und Modifikationsanleitungen zur K60 und Objektiven |
 | Stefan Scheibel: Mittelformat “Ost” Systemüberblick über das P6-System und die Kameras Praktisix, Pentacon six, Kiev 60 und Exakta 66, die Objektive verschiedener Hersteller sowie das Zubehör; kann auch als Ersatz für eine fehlende Anleitung herhalten und bietet Anregungen zum Selbstbau von Zubehör Lindemanns Verlag 98 S., (c) 1993, ISBN 3-89506-100-X |